- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
-
Lebensräume in Deutschland
- Küstenlebensräume & Binnensalzstellen
- Süßwasser
- Moore
- Pflanzenfreie und pflanzenarme Lebensräume
- Grünland & Heiden unterhalb der Baumgrenze
- Grünland & Heiden oberhalb der Baumgrenze
- Waldnahe Staudenfluren & Gebüsche
- Laubwälder
- Nadelwälder
- Häufig gestörte Flächen (Ruderalflächen)
- Agrarsonderkulturen mit hoher Flächenabdeckung (Gewächshäuser, Folientunnel)
- Alpine Vegetation mit regelmäßiger Trittbelastung
- Artenarme Bestände der nicht heimischen Goldrutenarten Solidago canadensis und S. gigantea
- Artenarme Hochstaudenfluren auf frischen Böden an Flussufern und in Brachen mit nicht heimischen Arten (Neophyten) wie drüsigem Springkraut und Riesen-Bärenklau
- Artenarme, konventionell bewirtschaftete Äcker
- Brachgefallene, grasige Feld- und Wegränder mit Quecke
- Fugenvegetation zwischen Pflastersteinen oder sonstigen Hartbelägen
- Hochstaudenfluren mit Mädesüß
- Kalkreiche, trockene Wegränder, Ruderalflächen oder Hackfruchtäcker mit wärmeliebenden Pflanzenarten wie dem kleinen Liebesgras
- Mäßig trockene Ruderalflächen mit Wilder Möhre und Steinklee
- Nährstoffreiche Flächen bei Ställen und auf Viehweiden der Alpen (Lägerfluren)
- Nährstoffreiche Ruderalflächen mit Großer Klette
- Nährstoffreiche, halbschattige Säume mittlerer Feuchte mit Knoblauchsrauke
- Nährstoffreiche, halbschattige und feuchte Säume und offene Flächen mit Girsch
- Obstbaum- und andere Plantagen, sowie Hopfenkulturen
- Ökologisch bewirtschaftete Kalk- und Ton-Getreideäcker mit ihren Wildkräutern
- Ökologisch bewirtschaftete kalkarme Getreideäcker mit ihren Wildkräutern
- Pestwurzfluren an Ufern von Mittelgebirgsbächen und -flüssen
- Ruderalflächen mit hochwachsenden Rauken
- Trockene Ruderalflächen und Säume mit Finger- und Borstenhirse
- Trockenwarme Ruderalflächen mit Eselsdisteln
- Trockenwarme, nährstoffreiche Ruderalflächen mit Gänsefußgewächsen
- Vegetation mit regelmäßiger Trittbelastung
- Weinberge und ihre Brachen
- Ökologisch bewirtschaftete Hackfruchtäcker und ihre Wildkräuter
- Zeitweilig trockenfallende Rohbodenflächen an Gewässerufern und auf Äckern mit einjährigen Zwergbinsengesellschaften
- Zeitweilig trockenfallende Schlammflächen an Gewässern oder im Kulturland mit Zweizahn- und Wasserpfefferfluren
- Zeitweise trockenfallende Schlammufer an größeren Flüsse mit Gänsefußfluren
- Zwerg-Lein-Gesellschaften an zeitweilig trockenfallenden Ufern von Flüssen und Seen
- Siedlungen & Siedlungsnähe
- Tiere
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Artenarme Bestände der nicht heimischen Goldrutenarten Solidago canadensis und S. gigantea
Ähnlich den Hochstaudenfluren auf feuchteren Standorten, können sich auf Ruderalflächen artenarme Bestände der nicht heimischen Kanadische Goldrute (Solidago canadensis) und Späte Goldrute (Solidago giantea) (Foto: gelb) ausbilden.
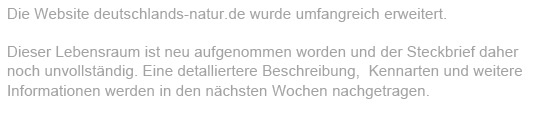
Besonderheiten
Die oben genannten Arten werden offiziell als invasive Arten bezeichnet. Sie stellen ein Problem dar, weil sie mit ihren Monokulturen heimische Pflanzen verdrängen und dadurch die biologische Vielfalt gefährden. Auch intensive und langjährige Bekämpfung ist oft erfolglos.
Tagfalter in diesem Lebensraum
Heuschrecken in diesem Lebensraum
Referenzlisten:

()
Schnellzugriff
Referenzlisten
| Bezüge zu anderen Listen: | |
| Ellenberg & Leuschner (2010) | – |
|---|---|
| Finck et al. (2017) | 39.05 |
| EUNIS 2021/22 | – |
| EuroVeg-Checklist | – |
| Delarze et al. (2015) | – |
| Natura 2000 | – |













