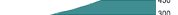- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Alpen-Gebirgsschrecke
- Alpen-Strauchschrecke
- Blauflügelige Ödlandschrecke
- Brauner Grashüpfer
- Feldgrille
- Gebirgs-Grashüpfer
- Gefleckte Schnarrschrecke
- Gemeine Eichenschrecke
- Gemeine Sichelschrecke
- Gemeiner Grashüpfer
- Gestreifte Zartschrecke
- Gewöhnliche Gebirgsschrecke
- Gewöhnliche Strauchschrecke
- Große Goldschrecke
- Große Höckerschrecke
- Großes Grünes Heupferd
- Hausgrille, Heimchen
- Heidegrashüpfer
- Italienische Schönschrecke
- Kiesbank-Grashüpfer
- Kleine Goldschrecke
- Kurzflügelige Schwertschrecke
- Langflügelige Schwertschrecke
- Laubholz-Säbelschrecke
- Lauchschrecke
- Plumpschrecke
- Punktierte Zartschrecke
- Roesels Beißschrecke
- Rote Keulenschrecke
- Rotflügelige Ödlandschecke
- Rotflügelige Schnarrschrecke
- Säbel-Dornschrecke
- Sibirische Keulenschrecke
- Steppen-Sattelschrecke
- Sumpfschrecke
- Tuerkis Dornschrecke
- Waldgrille
- Warzenbeißer
- Westliche Beißschrecke
- Zwitscher-Heupferd
- Wanzen
- Fliegen
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Gewöhnliche Strauchschrecke (Pholidoptera griseoaptera)
Gewöhnlichen Strauchschrecken erreichen eine Körperlänge von 13 bis 20 Millimetern (Männchen, Foto) bzw. 15 bis 20 Millimetern (Weibchen) und sind damit wesentlich kleiner als die ähnliche Alpen-Strauchschrecke (Pholidoptera aptera). Die sensenförmige, nach oben gekrümmte und sich gleichmäßig verjüngende Legeröhre (Ovipositor) der Weibchen ist nochmals 8 bis 10 Millimeter lang. Die Schrecken haben eine grau- bis dunkelbraune, selten rotbraune oder auch gelbbraune Körperfärbung, ihre Bauchseite ist markant gelb gefärbt. Die Seiten des Halsschildes sind sehr fein weiß gerandet, dies unterscheidet die Art von der Alpen-Strauchschrecke, bei der der Hinterrand des Halsschildes breit gelblich-weiß gefärbt ist.
Männchen und Weibchen der Gewöhnlichen Strauchschrecke sind flugunfähig, da die Flügel weitgehend zurückgebildet sind. Die Vorderflügel der Männchen sind abgerundet, nach oben gewölbt, braun, außen hellbraun bis ocker gefärbt. Gemäß ihren Funktionen zur Lauterzeugung sind bei den Männchen der linke und der rechte Vorderflügel unterschiedlich gestaltet. Die langen Cerci der Männchen sind nach dem ersten Viertel mit einem spitzen Zahn versehen.
Verbreitung

Die Gewöhnliche Strauchschrecke ist in ganz Deutschland verbreitet, wird jedoch zum Norden und Osten hin seltener. Lokal kann sie dort auch mal fehlen.
© Verbreitungskarte. Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V. (DGfO)
Ökologie
Die ausgewachsenen Tiere der Gewöhnlichen Strauchschrecke ernähren sich hauptsächlich räuberisch von kleinen Insekten, wie Blattläusen oder Raupen, fressen aber auch Pflanzen, wie Löwenzahn, Labkräuter oder Brennnesseln. Die Larven ernähren sich anfangs ausschließlich von pflanzlicher Kost. Die Tiere benötigen nur wenig Wärme und sind bereits bei Temperaturen über 7 °C aktiv.
Adulte Tiere haben eine versteckte Lebensweise und halten sich im hohen Gras oder zwischen krautigen Pflanzen auf, klettern auch auf Bäume, wo sie etwa in den Kronen von Grau- und Schwarz-Erlen nachgewiesen sind. Morgens sonnen sie sich, um schließlich im Laufe des Tages in die dichte Vegetation zu wandern. An kühlen oder feuchten Tagen halten sie sich auf der Sonnenseite ihres Habitats auf, ist es trocken und heiß, auf der Schattenseite.
Die Männchen singen vom Nachmittag bis tief in die Nacht. Da die Art nur wenig Wärme benötigt, kann man den Gesang auch in kühlen und feuchten Nächten, sogar nach Nachtfrösten wahrnehmen. Der Gesang ist bis zu 10 Meter weit hörbar.
Die Weibchen legen ihre Eier sowohl in den Erdboden als auch in abgestorbene Äste, Totholz und Ähnliches ab. Die Eier benötigen eine erhöhte Feuchtigkeit. Die Weibchen berücksichtigen dies und legen die Eier etwa in warmen Lebensräumen tiefer im schattigen Wald ab. Im Laufe ihrer Embryonalentwicklung gelangen die Eier meistens in die Laubschicht am Boden. Insgesamt werden etwa 200 der 4,5 mm langen und 1,2 mm breiten Eier abgelegt. Die Larven benötigen für ihre Entwicklung zwei volle Jahre und durchlaufen sieben Larvenstadien. Die im Herbst abgelegten Eier überwintern und entwickeln sich abhängig von den vorherrschenden Temperaturen im Laufe des darauf folgenden Sommers. Dem Sonnenlicht direkt ausgesetztes Bodensubstrat ermöglicht auf Grund der wärmeren Temperatur eine schnellere Entwicklung. Die Larven schlüpfen erst nach einer zweiten Überwinterung zwischen April und Juni des dritten Jahres. Häufig sitzen sie frei auf Blättern oder im Gras. Die ersten Imagines treten ab Juni auf und sind bis maximal Ende November zu beobachten.
Gefährdung
Die Art ist bei uns meist regelmäßig anzutreffen und nicht gefährdet. Sie gehört zu den häufigsten heimischen Laubheuschreckenarten.
Lebensraum
Gewöhnlichen Strauchschrecke besiedeln unterschiedliche Lebensräume mit mittelhohem bis hohem Pflanzenbewuchs, besonders Waldränder oder -lichtungen sowie Hecken und dichten Bewuchs entlang von Bachläufen, ferner hoch wachsende Wiesen und Ruderalflächen, Parks und Gärten
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Orthoptera |
|---|---|
| Familie | Tettigoniidae |
| Art | Gewöhnliche Strauchschrecke |
| Wiss. | Pholidoptera griseoaptera |
| Autor | (DeGeer, 1773) |
| Rote Liste D | - |
| Häufigkeit | sehr häufig |
| Länge | 1.3 - 2 cm |
| Eizahl | 200 |