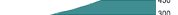- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Admiral
- Ähnlicher Perlmutterfalter
- Alexis-Bläuling
- Alpen-Perlmutterfalter
- Alpen-Weißling
- Alpen-Wiesenvögelchen
- Alpengelbling
- Alpenmatten-Perlmuttfalter
- Apollofalter, Apollo
- Argus-Bläuling
- Aurorafalter
- Baldrian-Scheckenfalter
- Baumweißling
- Berghexe
- Bergwald Mohrenfalter
- Bergweißling
- Blauer Eichenzipfelfalter
- Blaukernauge, Blauäugiger Waldportier
- Blauschillernder Feuerfalter
- Blauschwarzer Eisvogel
- Braunauge
- Brauner Eichen-Zipfelfalter
- Brauner Feuerfalter, Schwefelvögelchen
- Braunfleckiger-Perlmutterfalter
- Braunkolbiger Dickkopffalter
- Brombeer-Perlmuttfalter
- C-Falter
- Distelfalter
- Dukaten-Falter
- Dunkler Alpenbläuling
- Dunkler Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling
- Faulbaum-Bläuling
- Fetthennen-Bläuling
- Feuriger Perlmutterfalter
- Flockenblumen-Scheckenfalter
- Gelbgefleckter Mohrenfalter
- Gelbringfalter
- Gelbwürfeliger Dickkopffalter
- Gemeiner Bläuling
- Gletscherfalter
- Goldene Acht, Kleegelbling
- Goldener-Scheckenfalter
- Graubindiger Mohrenfalter
- Graubrauner Mohrenfalter
- Großer Eisvogel
- Großer Feuerfalter
- Großer Fuchs
- Großer Kohlweißling
- Großer Perlmutterfalter
- Großer Schillerfalter
- Großer Sonnenröschen-Bläuling
- Großer Wanderbläuling
- Großer-Waldportier
- Großes Ochsenauge
- Großes Wiesenvögelchen
- Grüner Zipfelfalter
- Heller Alpenbläuling
- Heller Wiesenknopf-Ameisen-Bläuling
- Himmelblauer Bläuling
- Hochalpenapollo
- Hochmoor-Bläuling
- Hochmoor-Perlmutterfalter
- Hochmoorgelbling
- Hufeisenkleegelbling
- Idas-Bläuling
- Kaisermantel
- Karstweißling
- Kleiner Eisvogel
- Kleiner Esparsetten-Bläuling
- Kleiner Feuerfalter
- Kleiner Fuchs
- Kleiner Kohlweißling
- Kleiner Mohrenfalter
- Kleiner Perlmutterfalter
- Kleiner Schillerfalter
- Kleiner Schlehen-Zipfelfalter
- Kleiner Sonnenröschen-Bläuling
- Kleiner Waldportier
- Kleiner Wanderbläuling
- Kleiner Würfel-Dickkopffalter
- Kleines Ochsenauge
- Kleines Wiesenvögelchen
- Komma-Dickkopffalter
- Kreuzdorn-Zipfelfalter
- Kronwicken-Dickkopffalter
- Kurzschwänziger Bläuling
- Landkärtchen
- Lilagold-Feuerfalter
- Mädesüß-Perlmutterfalter
- Magerrasen-Perlmutterfalter
- Malven-Dickkopffalter
- Mandeläugiger Mohrenfalter
- Mattscheckiger Dickkopffalter
- Mauerfuchs
- Mittlerer Perlmuttfalter
- Natterwurz-Perlmutterfalter
- Nierenfleck-Zipfelfalter
- Ockerbindiger Samtfalter
- Ostalpiner Scheckenfalter
- Pflaumen-Zipfelfalter
- Postillon, Wander-Gelbling
- Quellen-Mohrenfalter
- Quendel-Ameisenbläuling
- Randring-Perlmutterfalter
- Rapsweißling
- Reals Schmalflügel-Weißling
- Reseda-Weißling
- Resedaweißling
- Rostbraunes Wiesenvögelchen
- Rostfarbiger Dickkopffalter
- Rotbraunes Ochsenauge
- Roter Würfel-Dickkopffalter
- Roter-Scheckenfalter
- Rotklee-Bläuling
- Rundaugen-Mohrenfalter
- Schachbrett
- Schlüsselblumen-Würfelfalter
- Schornsteinfeger
- Schwalbenschwanz
- Schwarzer Apollo
- Schwarzkolbiger Braundickkopffalter
- Schweizer Schillernder Mohrenfalter
- Segelfalter
- Senfweisling
- Silberfleck-Perlmutterfalter
- Silbergrüner Bläuling
- Spiegelfleck-Dickkopffalter
- Storchschnabel-Bläuling
- Tagpfauenauge
- Trauermantel
- Ulmen-Zipfelfalter
- Unpunktierter Mohrenfalter
- Veilchen-Scheckenfalter
- Violetter Feuerfalter
- Wachtelweizen-Scheckenfalter
- Wald-Wiesenvögelchen
- Waldbrettspiel
- Wegerich-Scheckenfalter
- Weißbindiger Mohrenfalter
- Weißbindiges Wiesenvögelchen
- Weißdolch-Bläuling
- Weißer Waldportier
- Westlicher Quendel-Bläuling
- Westlicher Scheckenfalter
- Wundklee-Bläuling
- Zahnflügel-Bläuling
- Zitronenfalter
- Zwerg-Bläuling
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Wanzen
- Fliegen
- Tagfalter
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Karstweißling (Pieris mannii)
Der Karstweißling (Pieris mannii) hat eine Flügelspannweite von 40 bis 46 Millimeter. Bei der zweiten Generation reicht der schwarze Spitzenfleck auf der Oberseite der Vorderflügel am Außenrand bis zur Flügelader M3 oder Cu1. Auf der Oberseite der Hinterflügel ist der Randfleck halbmondförmig und nach außen konkav. Die Hinterflügelunterseiten sind gleichmäßig dunkel beschuppt.
Der Karstweißling kann leicht mit dem Kleinen Kohlweißling (Pieris rapae) verwechselt werden. Dieser hat ebenso dunkel gezeichnete Hinterflügelunterseiten, vor allem bei der Frühjahrsgeneration. Unterscheiden kann man die beiden Arten anhand des Spitzen- und Diskalflecks. Der Diskalfleck ist beim Karstweißling rechteckig und wuchtig, beim Kleinen Kohlweißling rund und klein ausgebildet. Die gedachte Verbindungslinie zwischen ihm und der Grenze des Apikalflecks am Flügelaußenrand verläuft bei der ähnlichen Art schräg, beim Karstweißling horizontal. Der Apikalfleck ist beim Karstweißling kräftig und ausgedehnt, und anders als bei der ähnlichen Art etwas stufenförmig und erreicht außerdem die Flügelader M3. Die Flügelspitze ist beim Karstweißling gerundeter, als bei der ähnlichen Art, außerdem befindet sich bei den Weibchen ein kleiner Fleck (Posteromaculata-Fleck) auf der Oberseite der Hinterflügel, der beim Kleinen Kohlweißling nur sehr selten auftritt.
Sicher kann der Karstweißling im Raupenstadium bestimmt werden, da die Raupen im ersten und zweiten Stadium eine schwarze Kopfkapsel aufweisen.
Verbreitung

Der Karstweißling ist im westlichen Mittelmeergebiet weit verbreitet und breitet sich aus, so dass er nicht nur wie früher auf den Norden der Schweiz beschränkt ist, sondern mittlerweile auch im überwiegenden Teil der Bundesländern in Deutschland nachgewiesen werden könnte. Es kann damit gerechnet werden, dass sie sich weiter in Deutschland ausbreitet bzw. häufiger nachgewiesen wird. Aktuell ist sie aber sicher noch selten.
© Die Verbreitungskarte wurden im Rahmen des LepiDiv-Projektes erstellt und von der Gesellschaft für Schmetterlingsschutz zur Verfügung gestellt.
Ökologie
Die Karstweißlinge sind häufig zwischen Bäumen und Sträuchern zu finden. Er fliegt je nach Höhenlage in zwei bis zumindest fünf Generationen pro Jahr von Mai bis August.
Als Raupen-Nahrungspflanzen der Art ist in großen Teilen Italiens und im Oberwallis das Blasenschötchen (Alyssoides utriculata) nachgewiesen. Anfangs werden die Fruchtkapseln, später wie auch bei den anderen Nahrungspflanzen die Blätter gefressen. Aus Südkalabrien ist die Art an Strand-Silberkraut (Lobularia maritima), in Südfrankreich und in den östlichen Pyrenäen an Grasblättriger Kresse (Lepidium graminifolium), Iberis linifolia, Felsen-Schleifenblume (Iberis saxatilis) und Immergrüner Schleifenblume (Iberis sempervirens) nachgewiesen. In Nordostitalien und am nordwestlichen Balkan fressen die Raupen an Schmalblättrigem Doppelsamen (Diplotaxis tenuifolia).
In Deutschland findet man die Raupen in Steingärten an Schleifenblumen (Iberis), die gezielte Nachsuche an diesen Pflanzen kann teilweise leichter zu Nachweisen führen, als die Suche nach Faltern. Die Puppen der letzten Generation überwintern.
Gefährdung
Da die Art als Neubürger bei uns begrüst wird, kann man über den Gefährdungsstatus wenig sagen, bzw. man hat offiziell auf eine Einstufung verzichtet.
Lebensraum
Der Karstweißling tritt in trockenen, temperaturbegünstigten, felsigen Gebieten auf. Man findet ihn zum Beispiel auf Karstflächen, felsigen Ziegenweiden und ausgedehntem steilem felsigem Terrain, auch in Wäldern. Da die Nahrungspflanze der Raupe - die Schleifenblumen - bei uns fast ausschließlich in Steingärten angebaut werden lohnt es sich auch, die Art dort zu suchen.
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Lepidoptera |
|---|---|
| Familie | Pieridae |
| Art | Karstweißling |
| Wiss. | Pieris mannii |
| Autor | (Mayer, 1851) |
| Häufigkeit | sehr selten |
| Spannweite | 4 - 4.6 cm |