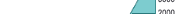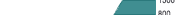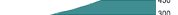- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Alpen-Gebirgsschrecke
- Alpen-Strauchschrecke
- Blauflügelige Ödlandschrecke
- Brauner Grashüpfer
- Feldgrille
- Gebirgs-Grashüpfer
- Gefleckte Schnarrschrecke
- Gemeine Eichenschrecke
- Gemeine Sichelschrecke
- Gemeiner Grashüpfer
- Gestreifte Zartschrecke
- Gewöhnliche Gebirgsschrecke
- Gewöhnliche Strauchschrecke
- Große Goldschrecke
- Große Höckerschrecke
- Großes Grünes Heupferd
- Hausgrille, Heimchen
- Heidegrashüpfer
- Italienische Schönschrecke
- Kiesbank-Grashüpfer
- Kleine Goldschrecke
- Kurzflügelige Schwertschrecke
- Langflügelige Schwertschrecke
- Laubholz-Säbelschrecke
- Lauchschrecke
- Plumpschrecke
- Punktierte Zartschrecke
- Roesels Beißschrecke
- Rote Keulenschrecke
- Rotflügelige Ödlandschecke
- Rotflügelige Schnarrschrecke
- Säbel-Dornschrecke
- Sibirische Keulenschrecke
- Steppen-Sattelschrecke
- Sumpfschrecke
- Tuerkis Dornschrecke
- Waldgrille
- Warzenbeißer
- Westliche Beißschrecke
- Zwitscher-Heupferd
- Wanzen
- Fliegen
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Rotflügelige Schnarrschrecke (Psophus stridulus)
Die Männchen der Rotflügelige Schnarrschrecke werden 23 bis 25, die Weibchen 26 bis 40 Millimeter lang. Die Weibchen sind gelbbraun oder grau gefärbt und haben einen etwas plumperen Körperbau als die fast schwarz gefärbten Männchen. Diese sind voll geflügelt, die Weibchen haben hingegen nur verkürzte Flügel.
Die Vorderflügel haben die gleiche Farbe wie der Körper, die Hinterflügel sind bis auf ihre Spitzen, die schwarz sind, kräftig rot gefärbt. Man kann diese gut während des Fluges erkennen, was eine gewisse Verwechslungsgefahr mit der Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) birgt. Die beiden Arten sind aber dadurch unterscheidbar, dass bei der Schnarrschrecke das Rot der Hinterflügel ausgedehnter ist und den Vorderflügeln die breiten hellen Querbinden fehlen. Auch besitzt die Rotflügelige Schnarrschrecke auf der Oberseite des Halsschildes einen hohen, durchgehenden Rückenkiel, der an beiden Seiten eine kleine Einbuchtung hat.
Verbreitung

Die Rotflügelige Schnarrschrecke ist bei uns sehr zerstreut verbreitet und in vielen Bundesländern nicht nachgewiesen bzw. ausgestorben. Aktuell kommt sie vorwiegend in den Nordalpen, Schwäbischer- und Fränkischer Alb, Bayerischer Wald und Rhön vor.
© Verbreitungskarte. Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V. (DGfO)
Ökologie
Die Rotflügelige Schnarrschrecke lebt vor allem in trockenen und steinigen Gebieten, wie etwa auf temperaturbegünstigtem Trockenrasen.
Die Tiere erzeugen mit den Hinterflügeln ein klapperndes Schnarren, das vermutlich gemeinsam mit den überraschend zu erkennenden roten Hinterflügeln zur Abschreckung von Fressfeinden dient. Bei den Männchen ist es auch Teil des komplizierten Balzrituals. Bei niedrigen Temperaturen und bei wiederholtem Aufschrecken wird der Ton nicht erzeugt. Weibchen schnarren auch im Sitzen. Nach der Paarung legt das Weibchen die Eier paketweise in den Boden, im darauffolgenden Frühsommer schlüpfen dann die Larven.
Gefährdung
Die Art ist bei uns selten und gilt als stark gefährdet. Die Art kam früher in Heidegebieten Norddeutschlands vor, ist dort aber ausgestorben.
Lebensraum
Trocken- und Halbtrockenrasen, Weiden, Wacholderheiden und Lichtungen. Auch auf bereits länger festliegenden und auch bewachsenen Schotterterassen von nordalpinen Flüssen.
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Orthoptera |
|---|---|
| Familie | Acrididae |
| Art | Rotflügelige Schnarrschrecke |
| Wiss. | Psophus stridulus |
| Autor | (Linnaeus, 1758) |
| Rote Liste D | 2 |
| Häufigkeit | selten |
| Länge | 1.9 - 3.5 cm |