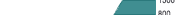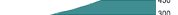- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Alpen-Gebirgsschrecke
- Alpen-Strauchschrecke
- Blauflügelige Ödlandschrecke
- Brauner Grashüpfer
- Feldgrille
- Gebirgs-Grashüpfer
- Gefleckte Schnarrschrecke
- Gemeine Eichenschrecke
- Gemeine Sichelschrecke
- Gemeiner Grashüpfer
- Gestreifte Zartschrecke
- Gewöhnliche Gebirgsschrecke
- Gewöhnliche Strauchschrecke
- Große Goldschrecke
- Große Höckerschrecke
- Großes Grünes Heupferd
- Hausgrille, Heimchen
- Heidegrashüpfer
- Italienische Schönschrecke
- Kiesbank-Grashüpfer
- Kleine Goldschrecke
- Kurzflügelige Schwertschrecke
- Langflügelige Schwertschrecke
- Laubholz-Säbelschrecke
- Lauchschrecke
- Plumpschrecke
- Punktierte Zartschrecke
- Roesels Beißschrecke
- Rote Keulenschrecke
- Rotflügelige Ödlandschecke
- Rotflügelige Schnarrschrecke
- Säbel-Dornschrecke
- Sibirische Keulenschrecke
- Steppen-Sattelschrecke
- Sumpfschrecke
- Tuerkis Dornschrecke
- Waldgrille
- Warzenbeißer
- Westliche Beißschrecke
- Zwitscher-Heupferd
- Wanzen
- Fliegen
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii)
Die Roesels Beißschrecken (Metrioptera roeselii syn.: Roeseliana roeselii)erreichen eine Körperlänge von 14 bis 19 Millimetern. Die Männchen sind kleiner als die Weibchen, dagegen sind bei den Männchen die Vorderflügel länger (Mittelwert: 8,35 Millimeter; Extremwerte: 7,2-10,0; 40 Männchen) als bei den Weibchen (Mittelwert: 6,09 Millimeter; Extremwerte: 4,5-8,2; 10 Weibchen). Die Vorderflügel sind in ihrer ganzen Länge breit. Die Hinterflügel sind bei beiden Geschlechtern sehr kurz. Die Mittelwerte betragen 2,87 Millimeter bei den Männchen und 3,02 Millimeter bei den Weibchen.
Der Körper der Roesels Beißschrecke hat eine grünolive, braune, rotbraune oder hellbraune Grundfarbe. Die Seitenlappen des Pronotums sind breit gelblichweiß bis hellgrün gerandet. Die Schenkel (Femora) der Hinterbeine tragen auf der Außenseite einen schwarzen Querstrich, oberhalb davon sind die Schenkel grünlich bis gelblich gefärbt. Die Cerci der Männchen haben am Beginn des apikalen Drittels einen langen, nach innen stehenden Dorn. Die Subgenitalplatte der Weibchen ist tief eingeschnitten; ihre Legeröhre (Ovipositor) ist 7 bis 8 Millimeter lang.
Die Flügel sind bräunlich gefärbt und erreichen meistens nur etwa die halbe Länge des Hinterleibs. Bei manchen Individuen (Foto) reichen sie jedoch bis an das Hinterleibsende oder überragen dieses sogar. Diese langgeflügelten (makropteren) Tiere treten bei vielen verschiedenen Arten - wenn auch selten - einmal auf. Eine Strategie der Natur, welche im Zusammenhang mit Ausbreitungsverhalten zu sehen ist.
Verbreitung

Die Roesels Beißschrecke ist in ganz Deutschland verbreitet und nicht selten. Nur im Norden ist sie etwas seltener zu finden.
© Verbreitungskarte. Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V. (DGfO)
Ökologie
Die Roesels Beißschrecke ist tagaktiv, gelegentlich kann man ihren Gesang auch nachts hören. Sie ernährt sich hauptsächlich von Gräsern; krautige Pflanzen und kleinere Insekten wie auch Artgenossen werden nur gelegentlich gefressen. Die Gräser werden an den Flächen abgeschabt und nicht im ganzen verzehrt. Die Weibchen legen ihre 4,5 bis 4,8 Millimeter langen und etwa ein Millimeter breiten Eier einzeln oder in kleinen Gruppen in markhaltige, frische wie dürre Stängel verschiedener Gräser, krautiger Pflanzen und Sträucher ab. Dazu wird zunächst ein Loch in den Stängel genagt, in das dann der Ovipositor eingeführt wird.
Die Larven schlüpfen im Frühjahr etwa ab Ende Mai, je nach Umweltbedingungen überliegen sie aber mitunter auch ein Jahr. Die Tiere durchleben in etwa 40 Tagen sieben Stadien bis sie ausgewachsen sind. Man findet die adulten Tiere von Ende Juni bis Ende Oktober. Sie sind relativ unempfindlich gegen Kälte und können auch leichte Nachtfröste unbeschadet überdauern.
Die Männchen werben mit einem weichen, etwa 10 Meter weit wahrnehmbaren, schwirrenden Gesang. Dieser umfasst etwa 75 Silben pro Sekunde und ist gleichmäßig, lange andauernd und wird nur durch kurze Pausen unterbrochen. Auf spätsommerlichen Wiesen ist es nicht selten der prägende, markante Heuschreckengesang.
Besonderheiten
Die Roesles Beißschrecke wird von einigen Autoren der Gattung Roeseliana zugeordnet, also als Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) geführt.
Lebensraum
Die Roesels Beißschrecke stellt keine hohen Ansprüche an ihren Lebensraum. Sie lebt in nicht zu intensiv bewirtschafteten und nicht zu trockenen Grünlandhabitaten.
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Orthoptera |
|---|---|
| Familie | Tettigoniidae |
| Art | Roesels Beißschrecke |
| Wiss. | Metrioptera roeselii |
| Autor | (Hagenbach, 1822) |
| Rote Liste D | - |
| Häufigkeit | sehr häufig |
| Länge | 1.8 - 2 cm |