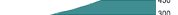- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Wanzen
- Tingis cardui
- Stictopleurus abutilon
- Stenotus binotatus
- Stagonomus bipunctatus
- Pilophorus confusus
- Orthops kalmii
- Capsodes gothicus
- Phytocoris varipes
- Carpocoris pudicus
- Holcostethus strictus
- Macrosaldula scotica
- Globiceps fulvicollis
- Beerenwanze
- Birkenwanze
- Braune Randwanze
- Bunte Blattwanze
- Fichtenzapfenwanze
- Fleckige Brutwanze
- Gelbsaum-Zierwanze
- Gemeine Bodenwanze
- Gemeine Feuerwanze
- Gemeine Getreidewanze
- Gemeine Wiesenwanze
- Gemeiner Hüpferling
- Gemeiner Wasserläufer
- Geringelte Mordwanze
- Getreidewanze
- Ginster-Baumwanze
- Grasweichwanze
- Große Randwanze
- Großer Bachläufer
- Grüne Distelwanze
- Grüne Stinkwanze
- Knappe
- Kohlwanze
- Krummfühlerwanze
- Luzernen-Zierwanze
- Nördliche Fruchtwanze
- Purpur-Fruchtwanze
- Rotbeinige Baumwanze
- Rotbraune Sichelwanze
- Rote Mordwanze
- Rote Weichwanze
- Schildkrötenwanze
- Schwalbenwurzwanze
- Schwarzrückige Gemüsewanze
- Schwimmwanze
- Spitzbauchwanze
- Staubwanze
- Streifenwanze
- Wacholder-Randwanze
- Wasserskorpion
- Winzige Blumenwanze
- Wipfel-Stachelwanze
- Zimtwanze
- Zweizähnige Dornwanze
- Fliegen
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Gemeine Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus)
Die Gemeine Feuerwanze erreicht eine Körperlänge von 9 bis 11,5 Millimeter und hat eine auffällige schwarz-rote Färbung. Der Halsschild ist am Rand rot, in der Mitte trägt er einen annähernd rechteckigen, schwarzen Fleck. Die Flügel der meisten Tiere sind verkürzt. Gelegentlich kann man aber voll geflügelte, flugfähige Individuen beobachten, vor allem Männchen. Die Hemielytren haben eine rote Grundfarbe, der Clavus und der mehr oder weniger vorhandene Ansatz der Membrane ist schwarz gefärbt. Darüber hinaus befindet sich ein großer, kreisrunder schwarzer Fleck in der Mitte der Hemielytren und ein weiterer kleiner nahe dem Flügelansatz. Das Schildchen (Scutellum) ist schwarz. Der Hinterleib ist am Rand rot, in der Mitte schwarz gefärbt. Die Beine, Fühler und der Kopf sind schwarz.
Die Nymphen der Gemeinen Feuerwanze kann man an ihrem überwiegend rot gefärbten Hinterleib erkennen, auf dem sich nur entlang des Rückens mehrere kleine schwarze Flecken befinden. Die Hemielytren sind nur als Ansatz entwickelt und komplett schwarz gefärbt.
Verbreitung
Die Art ist in Deutschland verbreitet und häufig. Nur an den nordwestlichen Küsten fehlt die Art teilweise.
Ökologie
Die Gemeinen Feuerwanzen saugen an den herabfallenden Samen von Linden (Tilia) und krautigen Malvengewächsen wie beispielsweise Hibiskus (Hibiscus), Eibisch (Althaea), Malven (Malva) und Stockrosen (Alcea) vor. Vermutlich ist ihr Wirtspflanzenspektrum aber größer und sie ernähren sich auch von anderen Gehölzen, wie etwa von Gewöhnlichen Robinien (Robinia pseudoacacia). Die Tiere saugen vermutlich zur Wasseraufnahme zusätzlich an Stängeln und Blättern der krautigen Pflanzen und gelegentlich auch an Insekteneiern, toten Insekten und Wirbeltieren. Auch Kannibalismus ist dokumentiert.
Die Gemeine Feuerwanze kommt häufig in Aggregationen mit unterschiedlichen Entwicklungsstadien vor. Man kann häufig Hunderte von Tieren an sonnigen Plätzen oder am Stammfuß von Linden finden. Die Aggregationen werden durch Pheromone zusammengehalten, durch die Aussonderung von Wehrsekreten lösen sich diese aber rasch auf.
Die Art steigt in den Alpen bis in eine Höhe von etwa 1.000 Metern.
Gefährdung
Die Art ist nicht gefährdet.
Unser Kommentar
Unter gärtnerischen Gesichtspunkten gelten Feuerwanzen als unschädlich, werden aber wegen ihres massenhaften Auftretens manchmal als sogenannte Lästlinge verfolgt. Das sollte der umweltbewusste Gärtner unterlassen.
Lebensraum
In Lebensräumen, wo die Nahrungsspflanzen wachsen. Am häufigsten kann man Feuerwanzen an Linden in Dörfern und Städten antreffen, auch in bäuerlichen Gärten, in denen z.B. Malven und Stockrosen angepflanzt werden. Linden trifft man in der Natur etwas seltener in Schluchtwäldern und wärmebegünstiten Eichen-Hainbuchenwäldern an. An sonnigen Ecken wird man ebenfalls Feuerwanzen antreffen können.
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Heteroptera |
|---|---|
| Familie | Pyrrhocoridae |
| Art | Gemeine Feuerwanze |
| Wiss. | Pyrrhocoris apterus |
| Autor | (Linnaeus, 1758) |
| Rote Liste D | - |
| Häufigkeit | häufig |
| Länge | 0.9 - 1.15 cm |
| Eizahl | 60 |