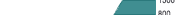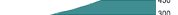- Themen
- Natura 2000
- Biotoptypen-Klassifikationen
- Lebensräume in Deutschland
-
Tiere
- Tagfalter
- Libellen
- Amphibien & Reptilien
- Süßwasserfische
- Käfer
- Säugetiere
- Heuschrecken
- Alpen-Gebirgsschrecke
- Alpen-Strauchschrecke
- Blauflügelige Ödlandschrecke
- Brauner Grashüpfer
- Feldgrille
- Gebirgs-Grashüpfer
- Gefleckte Schnarrschrecke
- Gemeine Eichenschrecke
- Gemeine Sichelschrecke
- Gemeiner Grashüpfer
- Gestreifte Zartschrecke
- Gewöhnliche Gebirgsschrecke
- Gewöhnliche Strauchschrecke
- Große Goldschrecke
- Große Höckerschrecke
- Großes Grünes Heupferd
- Hausgrille, Heimchen
- Heidegrashüpfer
- Italienische Schönschrecke
- Kiesbank-Grashüpfer
- Kleine Goldschrecke
- Kurzflügelige Schwertschrecke
- Langflügelige Schwertschrecke
- Laubholz-Säbelschrecke
- Lauchschrecke
- Plumpschrecke
- Punktierte Zartschrecke
- Roesels Beißschrecke
- Rote Keulenschrecke
- Rotflügelige Ödlandschecke
- Rotflügelige Schnarrschrecke
- Säbel-Dornschrecke
- Sibirische Keulenschrecke
- Steppen-Sattelschrecke
- Sumpfschrecke
- Tuerkis Dornschrecke
- Waldgrille
- Warzenbeißer
- Westliche Beißschrecke
- Zwitscher-Heupferd
- Wanzen
- Fliegen
- Pilze
- Pflanzen

© Alle Rechte vorbehalten. Interesse an dem Foto?
Rote Keulenschrecke (Gomphocerippus rufus)
Die Roten Keulenschrecken erreichen eine Körperlänge von 14 bis 16 Millimetern (Männchen) bzw. 17 bis 23 Millimetern (Weibchen). Die Grundfarbe variiert sehr stark und reicht in unterschiedlichen Schattierungen von braun nach grau, kann aber auch ockerfarben oder rötlich bis hin zu kräftig dunkelrot sein.
Charakteristisches Merkmal der Art sind die besonders beim Männchen gut ausgeprägten, lanzettförmig verbreiterten Fühlerkeulen, die schwarz gefärbt sind und eine weiße Spitze haben. Durch diese weiße Spitze ist die Art von anderen Arten, die ebenfalls solche Fühlerkeulen haben, gut zu unterscheiden.
Die Labial- und Maxillarpalpen sind weiß. Der Halsschild besitzt eine mittige Naht und ist von der Seite gesehen am Rücken gerade. Die häufig fein weiß gezeichneten Seitenkiele sind breit schwarz gesäumt und nach dem vorderen Drittel geknickt. Die graubraunen Vorderflügel sind am Vorderrand etwas ausgebuchtet, haben aber kein erweitertes Medialfeld. Sie sind bei den Männchen länger und reichen etwas über die Knie der Hinterbeine, bei den Weibchen reichen sie nicht ganz an die Knie heran. Das Ende des Hinterleibs der Männchen ist rotbraun bis rot.
Verbreitung

Die Rote Keulenschrecke kommt bei uns vorwiegend in südlicheren Bundesländern vor und ist dort häufig. Die Verbreitung nach Norden reicht etwa bis zur Höhe Berlins.
© Verbreitungskarte. Deutsche Gesellschaft für Orthopterologie e.V. (DGfO)
Ökologie
Die Rote Keulenschrecke ernährt sich von Pflanzenmaterial, vor allem von Süßgräsern, andere krautige Pflanzen und Binsen werden eher selten gefressen. Die Tiere vermeiden es, am Boden zu sitzen, sondern halten sich bevorzugt an höher gelegenen, besonnten Stellen auf, wie etwa auf Brombeerblättern aber auch krautigen Pflanzen. Sie sind flugfähig und besiedeln dadurch neue Ruderalflächen, die etwa durch Windbruch entstanden sind, aber nur einzelne Tiere einer Population bewegen sich auch über weitere Strecken fort, weswegen geeignete Verbindungen wie Waldränder oder Böschungen zwischen Teilpopulationen notwendig sind.
Die Tiere sind gute Kletterer in der Vegetation und können auch von dünnen Halmen problemlos abspringen. Die Imagines sind gegenüber Kälte und Schnee sehr tolerant und können stellenweise sogar bis Mitte Dezember beobachtet werden. Balz und Paarung Die Männchen beginnen bereits ein bis zwei Tage nach der letzten Häutung mit ihrem Gesang, die Weibchen erst nach weiteren sechs bis acht Tagen. Das gesamte Ritual ist recht komplex und kann ununterbrochen bis zu 15 Minuten andauern. Ist das Weibchen paarungswillig, antwortet es schließlich mit sehr leisen Lauten und die Paarung findet statt. Die Spermatophore wird bereits kurz nach Beginn der Paarung übertragen.
Die Weibchen legen ihre Eier in halbtrockenen Böden in das Wurzelgeflecht von Gräsern ab. Trockenere Böden werden gemieden, sandiges und kiesiges Terrain wird felsigem gegenüber bevorzugt. Pro Gelege werden etwa acht bis neun Eier in Eipaketen abgelegt, insgesamt legt ein Weibchen nur etwa fünf Gelege an. Das Loch wird nach der Eiablage mit kratzenden und stampfenden Bewegungen mit den Hinterbeinen verschlossen. Die im Herbst abgelegten Eier überwintern, die Larven schlüpfen erst im Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Ihre Entwicklung ist stark von der Temperatur abhängig und verläuft bei etwa 30 °C optimal. Die ersten adulten Tiere treten ab Ende Juni auf, die meisten sind im August voll entwickelt und leben bis weit in den Herbst hinein. Der Höhepunkt der Populationen befindet sich erst im September, sodass die Art im Spätherbst gegenüber anderen Heuschrecken dominant auftritt.
Gefährdung
Die Rote Keulenschrecke gilt in Deutschland nicht als gefährdet.
Lebensraum
Die Rote Keulenschrecke ist wärmeliebend und kommt in reich strukturierten Grünlandhabitaten vor: Verbuschte Wiesen, Waldränder, Saumgesellschaften, Böschungen, Wiesen und Weiden.
Lebensräume in denen die Art vorkommt
Die Texte dieses Artikels basieren in Teilen auf dem Wikipedia-Artikel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und stehen unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. Die Fotos dieser Webseite sind darin nicht eingeschlossen und unterliegen dem vollen Urheberrecht!

Schnellzugriff
Kenndaten
| Ordnung | Orthoptera |
|---|---|
| Familie | Acrididae |
| Art | Rote Keulenschrecke |
| Wiss. | Gomphocerippus rufus |
| Autor | (Linnaeus, 1758) |
| Rote Liste D | - |
| Häufigkeit | häufig |
| Länge | 1.6 - 2.3 cm |